2. Martin Bucer und Straßburg
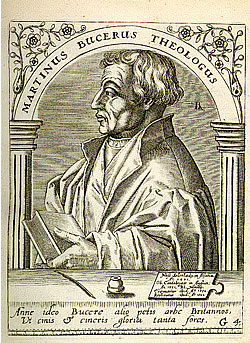 |
|
Martin Bucer
Boissard, Jean-Jacques; Bry, Theodor de: Bibliotheca chalcographica, hoc est Virtute et eruditione clarorum Virorum Imagines. Heidelberg: Clemens Ammon, 1669. Partes 1-5: 1669, S. 35 |
Martin Bucer und auch Straßburg gehören nur bedingt zur "Reformierten
Geschichte". Denn eigentlich verkörpert die sogenannte oberdeutsche
Reformation einen eigenständigen Typ neben dem lutherischen und
reformierten.
Martin Bucer (eigentlich: Butzer) wird am 11.11.1491 in Schlettstadt
(Elsaß) geboren. Er wird 15-jährig Dominikaner-Novize, studiert
in Heidelberg Theologie, verläßt 1521 das Kloster und wird
zunächst Weltpriester. Einschneidend ist für Bucer die Teilnahme
an Luthers Heidelberger Disputation 1518 gewesen. Seither ist Bucers
Theologie von der Rechtfertigungsbotschaft durchzogen. In den Jahren
1521 bis 1523 zeigt sich Bucer in der Nähe des humanistisch gesonnenen
Reichsritters Franz von Sickingen, wird Pfarrer in Landstuhl und Weißenburg,
heiratet die ehemalige Nonne Elisabeth Silbereisen und wird 1523 wegen
Heirat und reformatorischer Predigt vom Bischof aus Speyer exkommuniziert.
Er zieht in seine Heimat Straßburg und wird dort 1524 zum Pfarrer
gewählt, wo er die bereits eingeführte Reformation (u.a. wirkt
dort Wolfgang Capito) mit deutlichen Schritten vorantreibt. Dabei entwickelt
er eine eigene theologische Prägung, die ihn gleichermaßen
mit Luther verbindet wie auch von ihm trennt. Die Grundzüge der
Rechtfertigungslehre sind auch bei Bucer vorhanden: Der Mensch kann sich
nicht selber erlösen, er ist ganz und gar Sünder. Aber (und
hier setzt Bucer andere Akzente als Luther) das heißt nicht, daß der
glaubende Mensch, der erkennt, daß allein Gottes Gnade ihn errettet,
die Hände in den Schoß legen dürfte. Vielmehr befähigt
der Geist Gottes die Glaubenden zum Dienst am Nächsten - und führt
auch zu mancherlei Reformen in Kirche und Gesellschaft. Nur wenige Jahre
nach dem Beginn seiner Tätigkeit gilt Bucer Anfang der dreißiger
Jahre bereits als wichtigster Reformator der süddeutschen Städte.
Er wird zum Berater Philipps von Hessen, der seitens der Fürsten
zu den Wegbereitern der Reformation in Deutschland gehört. Überhaupt
ist Bucer sehr an der Einigung der verschiedenen protestantischen Lager
interessiert. Er arbeitet intensiv (und letztlich erfolglos) an einer
Verständigung im Verständnis des Abendmahls zwischen den Wittenbergern
und den Zürchern (denen er eher etwas näher steht). Luther
akzeptiert Bucers Zwischenstellung nicht. Und auch die Zürcher lehnen
nach dem Tode Zwinglis Bucers Einigungsbemühungen ab. Luther gelingt
es schließlich, Wittenberg und die evangelischen süddeutschen
Territorien, denen die Isolierung droht, zu einer (eher formalen) Übereinkunft
hinsichtlich des Abendmahls zu bewegen (Wittenberger Konkordie von 1536).
Die Folge ist, daß die süddeutschen Territorien sich mehrheitlich
dem Luthertum zuwenden.
Über die innerevangelischen Konsensbemühungen hinaus engagiert sich
Bucer auch führend in den sogenannten Religionsgesprächen in Hagenau,
Worms und Regensburg (1540/41), die das Ziel einer Einigung oder doch mindestens
Verständigung von evangelischen und katholischen Kirchen haben; diese Gespräche
scheitern aber.
Unterdessen geht Bucers eigene Reformtätigkeit in Straßburg
weiter - und manchen Straßburgern zu weit. 1548 muß Bucer
Straßburg verlassen und geht nach England, wo er von Cambridge
aus (wo er zum Doktor der Theologie promoviert wird) die Reformation
in England zu fördern sucht. Er wird aber nie heimisch in England
und stirbt 1551. Seine Gebeine werden 1557 im Zusammenhang der zeitweiligen
Rekatholisierung unter Königin Maria auf dem Marktplatz von Cambridge
verbrannt. Drei Jahre später aber wird Bucer von Königin Elisabeth
I. feierlich rehabilitiert.
Zwei Jahre später schreibt ein langjähriger Mitarbeiter Bucers,
Conrad Hubert, über Bucer: "... unter den treuen Dienern Christi
... war er keineswegs der geringste." Bucers unermüdlicher
Einsatz für die Verständigung zwischen den verschiedenen Lagern
und seine rastlose Tätigkeit zeigen Wirkungen, die weit über
seinen Tod hinausdauern. Bucers theologische Bedeutung ist im 20. Jahrhundert
neu entdeckt worden.