7. Rheinland und Niederrhein
Anders als in den bisher beschriebenen Regionen geschieht
die reformierte Konfessionalisierung im Rheinland nicht einheitlich. Ein
Grund dafür ist, daß die Herzöge im Rheinland zur Zeit
der Reformation viele verschiedene kleine sogenannte Unterherrschaften
besitzen, die z.T. von Grafen aus anderen deutschen Regionen regiert werden.
Einflüsse Luthers gibt es im Rheinland schon früh; ab 1519 studieren
viele Rheinländer z.B. in Wittenberg. Einzelne Adelsherrschaften
werden evangelisch. Das Schicksal des 1529 in Köln auf dem Scheiterhaufen
verbrannten Adolf Clarenbach, der sich an die lutherische Lehre hielt,
zeigt aber, daß sich die Reformation nur teilweise durchsetzen konnte.
Ein Kölner Reformationsversuch unter dem Erzbischof Hermann zur Wied
scheitert 1543. Er scheidet daraufhin aus seinem Amt. Das Nebeneinander
von katholischen und evangelischen Gemeinden bestimmt fortan das Rheinland.
Die Entstehung von reformierten Gemeinden geschieht auf zwei verschiedene
Weisen, einmal "von unten" und dann auch "von oben".
Bei der Reformation "von unten" ist zunächst an die Flüchtlingsgemeinden
zu erinnern. U.a. in Wesel, Aachen, Duisburg und Köln ließen
sich ab 1545 reformierte Glaubensflüchtlinge aus England, Frankreich
und den Niederlanden nieder. Sie bilden "nach Gottes Wort reformierte",
lebendige und gut organisierte Bekenntniskirchen und wirken dadurch wohl
anziehend für viele Einheimische. Eine ganze Reihe von "geheimen
Gemeinden" entstehen. Trotz der Erfolge gibt es Widerstände
und manche Repression, wobei besonders die Gemeinden am Niederrhein in
den niederländischen Freiheitskampf einbezogen werden und unter spanischer
Verfolgung zu leiden haben (in dieser Zeit entsteht die Selbstbezeichnung
"Gemeinden unter dem Kreuz"). In einem Weseler Konvent von 1568
kommen Delegierte aus den Flüchtlingsgemeinden aus Wesel, Emden und
London zusammen, um zu beraten, wie die von ihnen aufgebaute presbyterial-synodale
Ordnung erhalten werden kann. Die Emder Synode von 1571 "der niederländischen
Kirchen, die unter dem Kreuz und über Deutschland und Ostfriesland
verstreut sind" (so die Eigenbezeichnung) beschließt dann diese
Ordnung, in der sowohl die Selbständigkeit der einzelnen Gemeinde
wie auch der Zusammenhalt der Gemeinden geregelt wird. Diese presbyterial-synodale
Ordnung bestimmt bis in die Gegenwart hinein z.B. die Struktur der Ev.
Kirche im Rheinland.
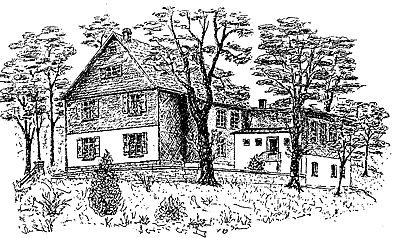 |
|
Pfarrhaus
Neviges
|
Neben dieser Reformation "von unten" gibt es auch die in Deutschland eher typische Einführung des reformierten Bekenntnisses in verschiedenen Unterherrschaften. So wirken verschiedene Herrschaften als "Protektoren" (H. Klueting) für das reformierte Bekenntnis sowohl in niederrheinischen Gebieten, im Bergischen Land, in Hohensolms-Braunfels und Wittgenstein, in Sayn-Altenkirchen und in Pfalz-Zweibrücken, so daß durchaus von einem "Vormarsch des Calvinismus" (E. Mülhaupt) gesprochen werden kann. Im Schutz der Bernsauer Herren tagt auch die erste reformierte bergische Synode 1589 in Neviges.
1610 findet in Duisburg die erste rheinische reformierte
Generalsynode statt, in der die presbyterial-synodale Ordnung für
die reformierten Gemeinden und Provinzialsynoden für die vier Landesteile
Jülich, Kleve, Berg und Grafschaft Mark beschlossen wird. 1671 wird
dies in einer Kirchenordnung festgelegt und detailliert ausgeführt.
Die Synoden haben sich im gesamten 17. und auch zu weiten Teilen im 18.
Jahrhundert als Kirchenleitung erwiesen, die den Kurs der Gemeinden zu
lenken imstande war. Gleichzeitig übernimmt als Nachfolger des letzten
Klever Herzogs der reformiert gewordene Brandenburger Kurfürst Johann
Sigismund die Herrschaft. Er stärkt die Reformierten u.a. mit der
Neugründung der reformierten Hochschule in Duisburg 1655.
Zwischen Lutheranern und Reformierten, aber auch innerhalb der Reformierten
finden zum Teil heftige Auseinandersetzungen über dogmatische Fragen
statt (z.B. um den freien Willen, die Prädestinationslehre etc.).
Wohl im Zusammenhang mit der Betonung auf die rechte Lehre (Ortho-doxie)
findet der Pietismus im 17. Jahrhundert sowohl in gemäßigter
als auch in schwärmerischer Ausformung Anklang bei vielen Reformierten.
Zu nennen ist hier beispielsweise die sog. "Ronsdorfer Rotte"
unter Elias Eller, die auf einer Anhöhe außerhalb von Elberfeld
das Gottesreich errichten, aber auch der zum mystischen Pietismus neigende,
sich aber nicht in der Mystik verlierende Gerhard Tersteegen (1697-1769),
dessen Wirkungen kaum zu überschätzen sind.
Die reformierten Gemeinden gehören heute zur "Evangelischen
Kirche im Rheinland". Ein Teil der Gemeinden ist reformiert geblieben,
ein anderer hat sich mit lutherischen Gemeinden zu unierten Gemeinden
vereinigt.